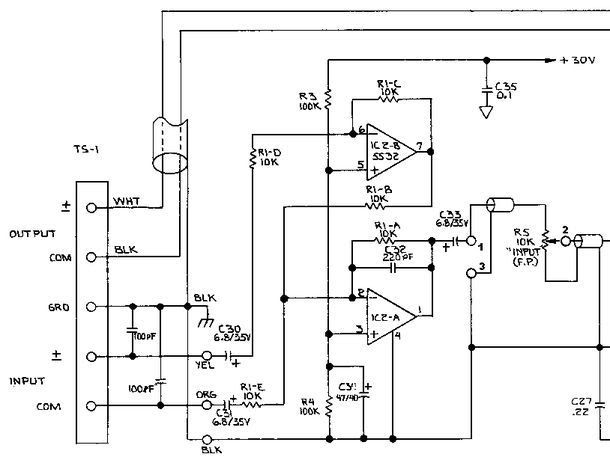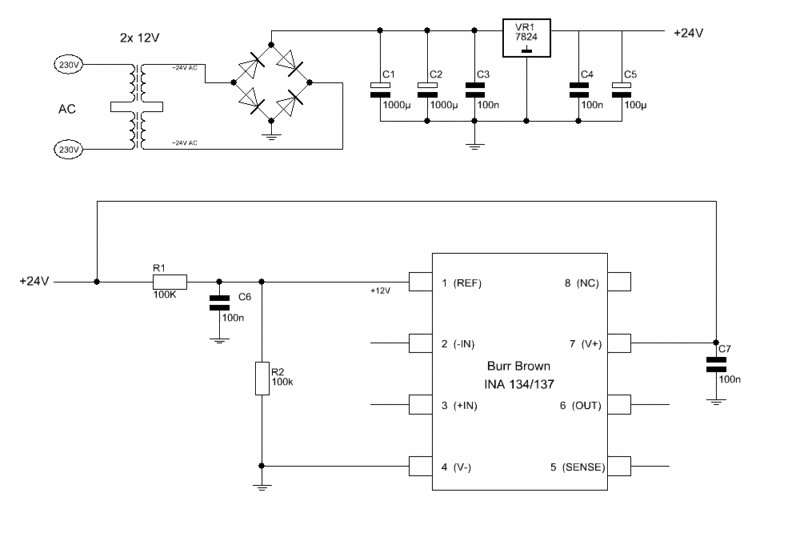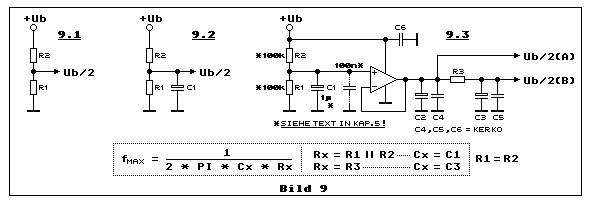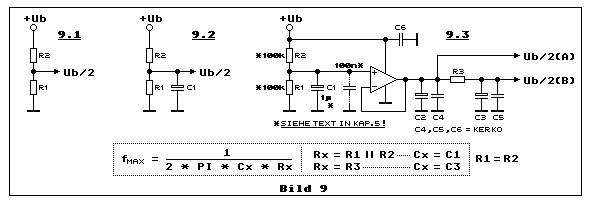
Bild 9 illustriert drei Beispiele wie die Spannung Ub/2 realisiert werden kann. Das einfachste Beispiel ist ein Spannungsteiler mit zwei gleich grossen Widerständen (Teilbild 9.1). Der Quellwiderstand dieser einfachen Schaltung ergibt sich durch die Berechnung der Parallelschaltung von R1 mit R2. Wie wir bereits wissen, muss dieser Quellwiderstand besonders niederohmig sein, wenn eine Verbindung zu einem Gegenkopplungsnetzwerk einer Opampschaltung besteht, damit die Verstärkung der Opampschaltung durch den Quellwiderstand dieser Ub/2-Quelle nicht signifikant beeinflusst wird. Für die Teilbild 5.2, 5.3 und 7.2 gilt, dass der Ub/2-Quellwiderstand stets wesentlich niederohmiger sein sollte als der Eingangswiderstand der angeschlossenen Schaltung. Dies gilt vorallem dann wenn niedrige Frequenzen oder sogar DC-Spannungen verstärkt werden müssen.
Wesentlich unkritischer ist es, wenn nur AC-Spannungen oberhalb einer minimalen Frequenz verstärkt werden müssen. Dann könnte man durchaus diese einfache Ub/2-Schaltung in Teilbild 9.2 verwenden, in dem parallel zu R1 ein Kondensator C1 geschaltet wird. Dieser sorgt dann oberhalb der minimalen Grenzfrequenz für eine entsprechend niedrige Quellimpedanz des R1-R2-C1-Netzwerkes. Man beachte, dass in diesem Fall nicht mehr von Quellwiderstand, sondern von Quellimpedanz die Rede ist. Es handelt sich um einen komplexen Widerstand. Die Grenzfrequenz des passiven R1-R2-C1-Tiefpassfilter sollte wesentlich niederfrequenter dimensioniert sein, als die untere Grenzfrequenz der involvierten Verstärkerschaltung! Diese Überlegungen gelten nur, wenn Ub/2 von Teilbild 9.2 DC-mässig praktisch unbelastet bleibt!
Besonders dann, wenn eine Ub/2-Spannungsquelle an vielen Stellen in einer Schaltung als Referenz dient, eignet sich die Lösung mit einem Opamp, der mit Verstärkung 1 bloss als Impedanzwandler arbeitet, am besten. Man betrachte dazu Teilbild 9.3. R1 und R2 arbeiten wiederum als Spannungsteiler, jedoch hat C1 hier eine etwas andere Funktion. Im Gegensatz zur passiven Schaltung, dürfen hier R1 und R2, besonders beim Einsatz von BiFET-Opamps (z.B. LF356, TL06x oder TL07x), hochohmig gewählt werden, - z.B. mit je 10 M-Ohm. Vernünftiger sind allerdings Werte im 100-k-Ohm-Bereich. C1 muss daher auch nicht besonders hochkapazitiv ausfallen. C1 unterdrückt hier nur Stör- und Rauschspannungen. Störspannungen entstehen durch kapazitive Einkopplung benachbarter AC-Spannungen (Leiterbahnen) auf den Eingangsteil dieser Schaltung. Ist die Zeitkonstante durch C1 und R1|R2 (parallel) sehr gross, weil die Grenzfrequenz sehr niedrig ist, dauert es beim Einschalten der Betriebspannung +Ub lange bis sich die Referenzspannung auf Ub/2 eingestellt hat. An so etwas ist bei der Schaltungsdimensionierung auch zu denken.
C1 hat keinen direkten Einfluss auf die Schaltung welche an Ub/2 angeschlossen wird, wie dies im Sinne der passiven Schaltung (Teilbild 9.2) der Fall ist. Wozu aber C2 am Ausgang des Opamps, der doch durch die starke Gegenkopplung besonders niederohmig sein soll? Niederohmig ist er schon, aber nicht niederimpedant. Ich erinnere daran, dass bei höheren Frequenzen die Leerlaufverstärkung eines Opamp (wegen seiner (internen) Frequenzgangkompensation) abnimmt. Diese Abnahme hat zur Folge, dass der Ausgangswiderstand ansteigt und dies könnte sich ungünstig auf die gesamte Schaltung auswirken, wenn höhere Signalfrequenzen mit im Spiel sind. C2, vozugsweise ein Tantal-Elko mit einem Wert von 10 µF bis 100 µF am Ausgang des Opamp, stellt eine niedrige Impedanz bei mittleren und höheren Frequenzen sicher. Man kann auch einen "normalen" Elko mit einem parallelgeschalteten Multilayerkondensator von etwa 100 nF verwenden. Will man zusätzlich niederfrequentes Rauschen des Opamp reduzieren, empfiehlt sich am Ausgang des Opamp ein zusätzlich niederimpedantes passives Tiefpassfilter mit R3 und C3. R3 von wenigen zehn bis wenigen hundert Ohm und C3 im 100 µF-Bereich, und parallel dazu ebenso einen Multilayerkondensator mit einer Kapazität von 100 nF, wenn kein Tantal-Elko zum Einsatz kommt.
BTW.: Das Ansteigen des Ausgangswiderstandes bei zunehmender Frequenz ist das typische Verhalten einer Induktivität. Wir haben es hier mit einer parasitären Induktivität zu tun. Man merke sich dies, weil, wenn man den Ausgang des Opamps kapazitiv zu wenig belastet, kann das Eigenrauschen des Opamps bei einer gewissen Resonanzfrequenz einen überhöhten Wert annehmen. Genau das selbe Problem hat man mit den dreibeinigen Spannungsreglern. R.A. Pease beschreibt dieses Phänomen in seinem Buch "TROUBLESHOOTING IN ANALOGSCHALTUNGEN" im Anhang C unter "Störspannungen an Dreibein-Spannungsreglern verstehen und reduzieren" sehr genau. Dieses Buch kann ich sehr empfehlen! Für Leute welche die englische Sprache gut beherrschen, empfiehlt sich, wegen der mangelhaften deutschen Übersetzung, die englischsprachige Ausgabe. (Das sagen diejenigen die englisch gut beherrschen, zu denen ich nicht gehöre...)